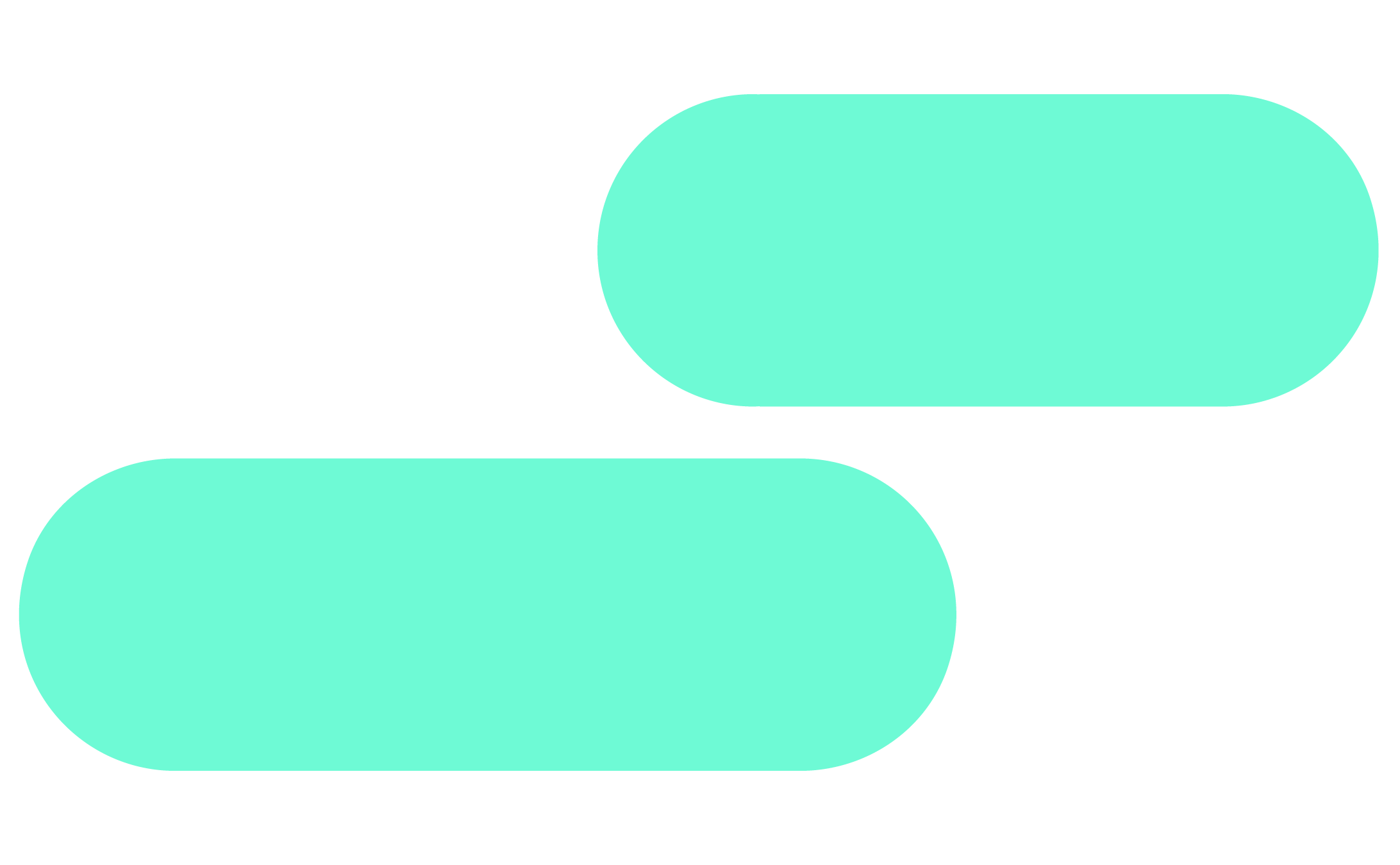Von Stefan Schlegel – Noch ist es zu früh um abzuschätzen, ob die Ereignisse in Tunesien und Ägypten zu einer echten Demokratisierung in der arabischen Welt führen werden. Aber sie sind Anlass, unsere Sicht auf die arabischen Gesellschaften gründlich zu korrigieren.
Sind die Bürgerproteste, die in Tunesien den Sturz des Regimes herbeigeführt haben der Anstoss für einen Domino-Effekt? Sind sie der erste Akt in einer Zeitenwende, vergleichbar mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Blockes in Mittel- und Osteuropa im Jahre 1989?
Käme es zu einer Reihe von Umstürzen, an die sich wirklich freie Wahlen anschliessen würden, so wäre die Zeitenwende durchaus mit derjenigen von 1989 vergleichbar. Wie damals bedeutete sie das Ende eines jahrzehntelangen grundsätzlichen Gegensatzes zweier grosser Staatenblöcke und zweier grundsätzlich unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle zwischen denen – ob zu Recht oder zu Unrecht – seit dem Ende des kalten Krieges die Möglichkeit eines clash of cultures beschworen wurde, der vielen als ein ebenso apokalyptisches Szenario erschien wie zuvor die Möglichkeit eines dritten Weltkriegs.
„Wir sind das Volk!“
Auf mindestens einen Staat ist der Funken nun übergesprungen. In Ägypten skandieren die Massen eine Parole, die aus Tunesien stammt: „Ash-shaab yurid iskat an-nizam!“ – „Das Volk will den Sturz des Systems!“ Die Parallele zum Kampfruf „Wir sind das Volk!“, der sich 1989 von einer Hauptstadt des damaligen Ostblocks zur nächsten fortpflanzte, ist augenfällig. Und auch in Ägypten scheint der Punkt überschritten zu sein, von dem es noch einen Rückweg zur bisherigen Normalität gibt.
Jahrzehnte voller Rückschläge
Dennoch wäre es im Moment noch verfrüht und pathetisch, von einem „Arabischen Frühling“ zu sprechen. Niemand kann abschätzen, ob in Tunesien die Transformation zu einem demokratischen Rechtsstaat tatsächlich gelingt, ob die ägyptische Bevölkerung von einer blutigen Unterdrückung ihrer Wut verschont bleibt und ob die Proteste auch in Jordanien, Jemen oder Algerien an Fahrt aufnehmen werden. Auch sollten die Erfahrungen aus der Zeitenwende von 1989 lehren, dass der Prozess der Demokratisierung nicht mit einigen geschichtsträchtigen Tagen auf der Strasse abgeschlossen wird, sondern Jahrzehnte dauert, in denen es immer wieder zur Rückschlägen kommt.
„Für Demokratie ungeeignet“
Die Ereignisse in Tunesien und Ägypten sollten jedoch genügen, nicht nur das Selbstverständnis der arabischen Welt, sondern auch den gängigen Blick des Westens auf die Region gründlich zu korrigieren. So ist die Aussage, „Die Araber sind nicht für Demokratie geschaffen“, die ein Sprecher des Emirates Bahrain am WEF gemacht hat zwar zu explizit, als dass sie von einem Meinungsmacher der westlichen Welt stammen könnte. Doch gibt es keinen Zweifel daran, dass viele Akteure, die das Verhältnis des Westens zur arabischen Welt bisher geprägt haben, insgeheim ebenfalls davon ausgingen, dass Demokratie für die arabische Welt eine ungeeignete Gesellschaftsform sei. Bisher hat die westliche Aussenpolitik zwei möglichen Alternativen für arabische Staaten erwogen: Entweder säkuläre Tyrannen, deren Polizeistaaten zumindest Stabilität garantieren oder islamistische Volksbewegungen, die einen Gottesstaat errichten wollen und dem internationalen Terrorismus ein Refugium bieten würden. Besonders für Ägypten, das im Nahostkonflikt bisher eine stabilisierende Rolle gespielt hat und eine zwar verbotene, aber starke islamistische Opposition hat, galt dieser Gegensatz. Doch auch im Fall Tunesiens war ein möglicher Gottesstaat der Grund für den Westen, die Tyrannei zu stützten. „Hätten Sie denn an seiner Stelle lieber ein Taliban-Regime?“, fragte Nicolas Sarkozy zurück, als ihn ein Journalist fragte, warum er den Polizeistaat von Ben Ali stütze.
Nicht bloss Fahnenverbrenner
Dass es den islamistischen Bewegungen in Tunesien und Ägypten bisher nicht gelungen ist, die Dynamik des Aufstandes für sich zu vereinnahmen und dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Staaten nicht bloss auf die Strasse gehen um – aufgehetzt von radikalen Imamen –die Fahnen westlicher Staaten zu verbrennen, erteilt uns die überraschende Lektion, dass die Bedürfnisse dieser Menschen unseren Bedürfnissen viel ähnlicher sind, als wir bisher bereit waren, anzunehmen. Genau wie wir wünschen sie sich in erster Linie eine Arbeit, von der sie leben können und die Möglichkeit, ihren Kindern eine Zukunft zu bieten.
Dass uns diese Erkenntnis überrascht, ist kein gutes Zeichen für die Einstellung, die wir fremden Gesellschaften gegenüber pflegen. Was unterscheidet Tunesier und Ägypter von Ungaren oder Tschechen, denen man schon vor 1989 in Westeuropa ohne weiteres zugetraut hat, Demokratie und wirtschaftliche Prosperität zu wollen? Der Unterschied ist, dass sie uns fremder sind, und nicht dass sie ein schwächeres Bedürfnis oder eine schlechtere Veranlagung für Demokratie haben.
Für die Aussenpolitik des Westens gegenüber arabischen Staaten heisst das, dieselbe Lektion zu lernen, die auch die arabischen Staatschefs im Moment augenreibend zur Kenntnis nehmen müssen: Auch Freiheit zählt, nicht nur Stabilität.
Die Zeiten, in denen arabische Staaten nur durch Autokraten nach Aussen vertreten waren und die Bedürfnisse der Bevölkerung schlichtweg keine Rolle gespielt haben, sind vorbei.
Der Luxemburgische Aussenminister Jean Asselborn sagte heute stellvertretend für alle EU-Aussenminister und leicht verwundert über sich selbst: „Wir haben unseren Fokus immer auf die internationale Politik gesetzt. Und wir haben ein wenig vergessen, dass Menschen dort leben, die mitbestimmen wollen.“
Stefan Schlegel lebt in Bern. Er ist Jurist und Gründungsmitglied von foraus – Forum Aussenpolitik. Er leitet die Arbeitsgruppe Migration und ist Mitglied der Redaktion des foraus-Blog.