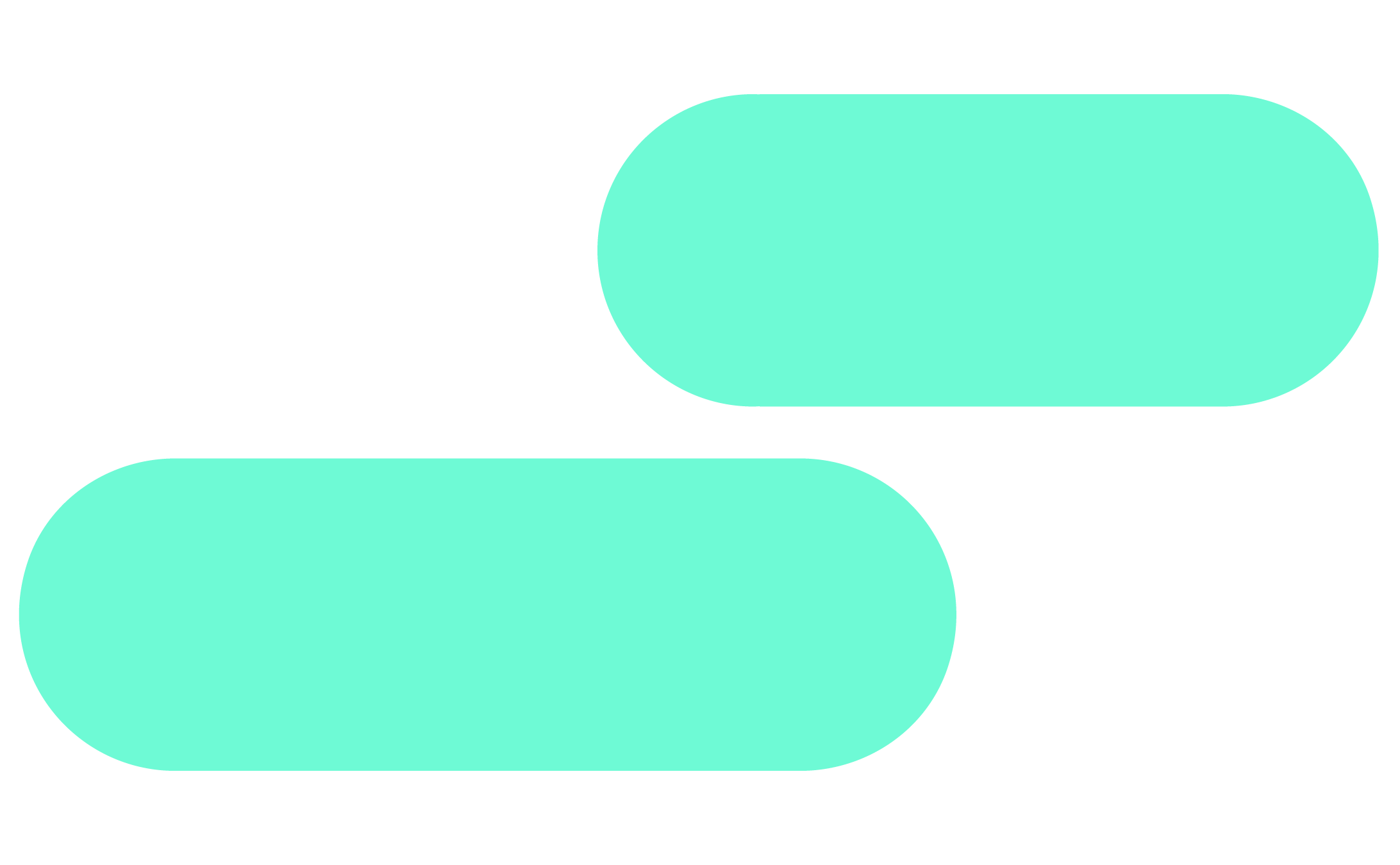Vor der Küste Westafrikas verschwinden die Fischbestände, die Generationen von Küstenbewohnern ernährt
haben. Europas Fischereiabkommen und illegale industrielle Flotten verschärfen die Krise und treiben Menschen
zur Migration
Vor der Atlantikküste Senegals und Gambias liegt eines der fischreichsten Gebiete der Welt. Jahrzehntelang konnten lokale Fischerfamilien hier von ihrem Fang leben, bis die Netze immer leerer wurden und die Boote immer weiter hinausfahren mussten. Was als lokale Krise beginnt, mündet in einem globalen Kreislauf aus Ausbeutung, Konsum und Migration.
Europas Subventionen, Afrikas Verlust
Eine erste Ursache für die Überfischung liegt in den Fischereiabkommen (Sustainable Fisheries Partnership Agreements, SFPAs), die die Europäische Union seit den 1980er Jahren mit westafrikanischen Staaten schliesst. Diese sollen eine nachhaltige Entwicklung des Fischereisektors in den Partnerländern fördern, während sie der EU zugleich erlauben, Überschussbestände in den Gewässern der Partnerstaaten zu fischen.
Die EU zahlt Millionen an westafrikanische Regierungen für das Recht, in ihren Gewässern zu fischen. Doch das Geld fliesst nur teilweise in den Fischereisektor, wie das Beispiel Mauretanien zeigt: Von den mehr als 60 Millionen Euro, die jährlich gezahlt werden, kommen nur etwas mehr als drei Millionen Euro dem Fischereisektor zugute – die restlichen Millionen gehen an die Regierung als Ausgleichszahlungen für die Zugangsrechte.
Der Fang wird meist in Form von Fischmehl und Fischöl exportiert, das aus kleineren Arten wie Sardinella oder Bonga hergestellt wird. Die Nachfrage in Europa ist hoch, insbesondere in der Aquakultur, beispielsweise in Norwegen zur Lachsfütterung, oder allgemein als Tierfutter. Auch werden die kleinen Fische als Köder beim Fang von Thunfisch eingesetzt.
Überfischung und Zerstörung ökologischer und sozialer Systeme
In Westafrika ist des Weiteren illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, IUU) weit verbreitet. Dazu gehören unter anderem unerlaubte Fischerei, der Einsatz verbotener Fanggeräte und -techniken, Fischfang in fremden Gebieten oder Fischerei während verbotener Zeiten. Ein großer Teil der IUU-Fischerei wird von industriellen Fangflotten aus Drittstaaten verübt, häufig unter sogenannten Billigflaggen (Flag of Convenience, FOC) oder unter den Flaggen von Ländern, mit denen Fischereiabkommen bestehen. Damit wird es für Küstenstaaten noch schwieriger, Herkunft und Rechtmäßigkeit der Fangaktivitäten zu kontrollieren. In den letzten zwanzig Jahren ist die IUU-Fischerei stark gestiegen; in einigen Ländern liegt der illegale Fang inzwischen fast auf dem Niveau des legalen.
Spezifisch in Gambia existiert zudem das Problem, dass das Land im Gegensatz zu den meisten Ländern der Subregion weder einen nationalen Aktionsplan gegen IUU-Fischerei noch eine Kontroll- und Überwachungsstruktur entwickelt hat, weswegen gegen den illegalen Fischfang nicht vorgegangen werden kann. Auch sind die Regelungen bezüglich der Fischereizonen verwirrend, was immer wieder zu Konflikten zwischen lokalen Fischern und industriellen Schiffen auf See führt.
Die Folgen der industriellen Hochseefischerei, einschließlich der IUU-Fischerei, sind dramatisch. Forschungen zeigen, dass die Fischbestände vor der westafrikanischen Küste in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen sind. Grundschleppnetze reissen Korallenriffe und Seegrasböden mit, die eigentlich als Brut- und Aufwuchsgebiete vieler Fische, Krebse und anderer Meeresarten dienen.
Flucht als letzte Option
Der Niedergang der Fischbestände trifft vor allem die Küstenbevölkerung, die am wenigsten zur Krise beigetragen hat. Mit einfachen Booten haben lokale Fischer keine Chance gegen industrielle Trawler und verlieren damit ihre wichtigste Einkommensquelle. Wenn das Meer keine Fische mehr hergibt, kollabiert eine ganze soziale Struktur. Menschen, deren Lebensunterhalt vom Fischfang abhängt – sei es durch direkten Fischfang oder durch Verarbeitung, Transport, Verkauf und Bootsbau – verlieren ihre Lebensgrundlage.
So sehen viele junge Menschen aus der Region, meist Männer, in der Migration die einzige Möglichkeit, ihre Familien zu ernähren. Die Überfischung ist dabei kein isolierter Faktor, sondern Teil eines grösseren Systems: Europas Fischereiabkommen und die IUU-Fischerei schaffen Bedingungen, die Menschen in die Flucht treiben.
Während beispielsweise im Senegal fast die Hälfte der Migrationsbewegungen innerhalb der Region stattfindet, versuchen viele auch den Weg über die Atlantikroute, die heute als gefährlichste Fluchtroute der Welt gilt. Konkrete Zahlen zur Anzahl derer, die diese Flucht unternehmen, sind schwer zu finden, aber in Gambia und Senegal ist es üblich, junge Menschen über ihre Fluchtversuche sprechen zu hören. Immer wieder kentern Boote zwischen Westafrika und den Kanarischen Inseln; Tausende verlieren jedes Jahr bei der Überfahrt ihr Leben.
Ironischerweise landen manche der Überlebenden in Europa, in Ländern, deren Fischereipolitik zur Zerstörung ihrer Heimat beigetragen hat. Doch statt eines Neuanfangs erwartet sie dort meist neue Formen der Abhängigkeit und Ausbeutung.
Ein Spiegel globaler Ungleichheit
Der Zusammenhang zwischen vollen Fischregalen in Europa und leeren Netzen in Westafrika zeigt, wie ungleiche Handelsbeziehungen lokale Ökonomien zerstören und Migration fördern. Solange industrielle Flotten westafrikanische Gewässer ausbeuten, bleibt das Problem bestehen. „Nachhaltige“ Abkommen dürfen nicht dazu führen, dass europäischer Bedarf auf Kosten überfischter Meere und der Zukunft der Küstengemeinden gedeckt wird.
Die SFPAs mit Gambia und Senegal sind derzeit pausiert. Ohne aktive Protokolle dürfen EU-Flotten nicht fischen, und es fliessen keine Subventionen. Genau darin liegt eine Chance: für einen echten Dialog, gerechtere Abkommen, bessere Kontrolle gegen illegale Fischerei und die Stärkung des lokalen Fischereisektors, damit er seine Zukunft selbst bestimmen kann.